
Wasserwesen, Luftwesen, Erdwesen – und natürlich Drachen: „The Vale of Eternity“ (Eric Hong bei Mandoo Games / Pegasus Spiele) ist bevölkert von einer bunten Menagerie mythischer Wesen. Und sie alle wollen ihren Beitrag zur wachsenden Anzahl an Siegpunkten leisten. Wenn da nicht die ein oder andere Regelbeschränkung im Weg wäre. Unsere Jurymitglieder sind in ihren jeweiligen Medien ins Tal der mythischen Kreaturen herabgestiegen und haben versucht, sie für viele, viele Siegpunkte zu zähmen.
„Wir sammeln Karten und spielen sie aus“, erklärt Udo Bartsch das Spiel. „Die Karten (eigentlich: ‚Kreaturen‘) haben Sofort- oder permanente Effekte oder einen Effekt, der exakt einmal pro Runde ausgeführt wird. Die schönsten Effekte bringen Punkte. Denn um Punkte geht es nun mal. Erreicht jemand 60, endet die Partie. ‚The Vale of Eternity‘ ist also ein Wettlauf. Karten auszuspielen, kostet zwischen null und zwölf Geld (‚Runensteine‘). Es gibt nur Einer-, Dreier- und Sechser-Münzen. Ich darf nicht wechseln. Und ich darf nur vier Münzen besitzen. Neue Münzen erhalte ich entweder über Effekte meiner gespielten Karten. Oder indem ich auf das Nehmen von Karten verzichte. In meinem Spielzug darf ich außerdem Karten von meiner Hand spielen und Karten aus meiner Auslage abwerfen, was zwar Geld kostet, manchmal aber nötig ist, um weitere Karten spielen zu dürfen. Denn man darf nie mehr ausliegen haben, als die aktuelle Rundenzahl beträgt.“
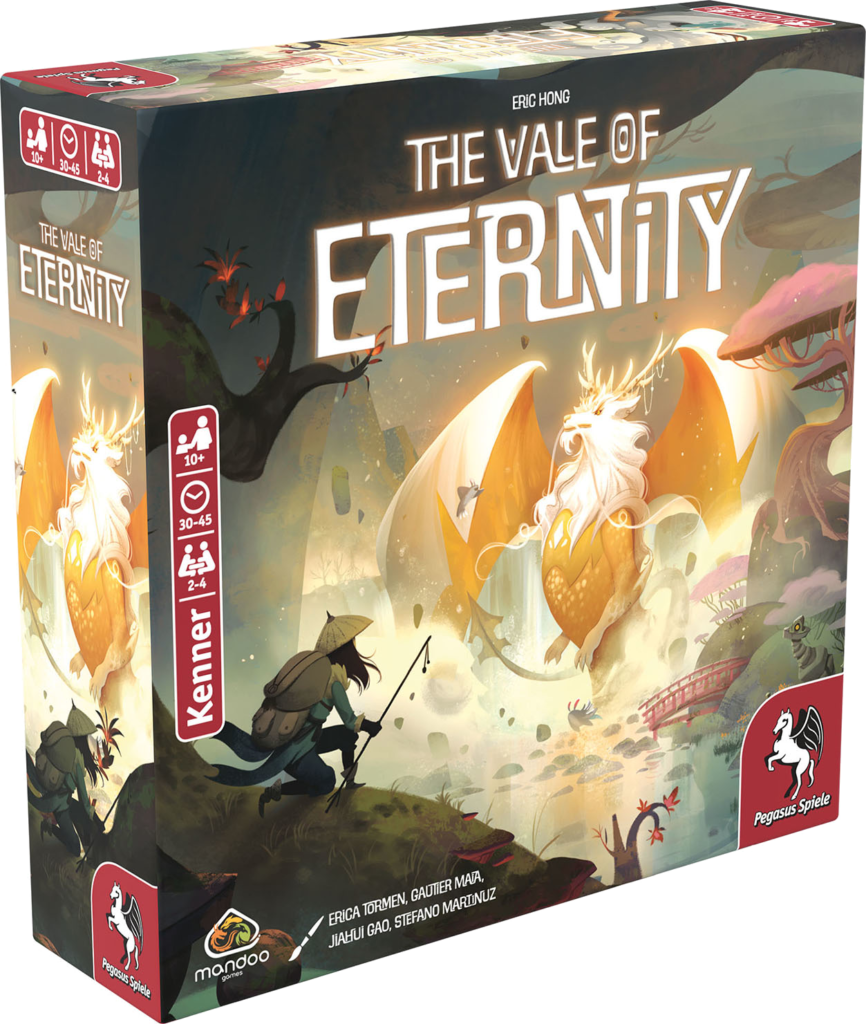
„Steten Druck“ fühlt Bartsch vor allem durch das Münzmanagement. „Es würde mich ärgern, Münzeinnahmen verfallen zu lassen, weil mein Münzvorrat zu groß ist. Im Bestfall gebe ich also erst mal viel aus, bevor ich große Einnahmen kassiere. Aber vielleicht reicht mein Vermögen nicht, und ich müsste zuerst noch was einnehmen, bevor ich meine Wunschkarte spielen kann… Dilemma!“, schreibt er. Gleichzeitig sieht er in dem Spiel einen großen Glücksfaktor am Werk: „Insofern ist es natürlich auch Glück, ob die Dinge eintreffen, wie ich sie mir ausmale, ob Karten kommen, auf die ich mit meinem eingeschlagenen Weg spekuliere. In manchen Partien läuft wenig zusammen, und da ist es immerhin ein Trost, dass spätestens nach zehn Runden Schluss wäre, selbst wenn niemand die 60 Punkte knackt.“ Das Tempo des Spiels könne durch Erstspieler gebremst werden, „gerade zu viert, wenn jedes Mal acht Karten ausgelegt werden, die alle Spieler:innen lesen und erfassen müssen. Der Kartenmarkt ist kreisförmig angeordnet. Deshalb liegt immer irgendwas für irgendwen über Kopf“, schreibt Bartsch. Dieser „mühsame“ Einstieg sei ein Manko des Spiels. Dennoch: „Erfahrungen mit Gruppen, die das an sich schnelle Wettlaufspiel durch langes Kartenanalysieren und Karten-noch-mal-Analysieren in ein Schneckenrennen verwandeln, sehe ich als Problem dieser Gruppen an, nicht des Spiels“, urteilt Bartsch. Insgesamt ist er von dem Spiel „positiv überrascht“: „‚The Vale of Eternity‘ ist eine Spielwiese, die mich zu immer neuen Partien verlockt, weil ich neugierig bin, was beim nächsten Mal passiert, welche Effekte und Kombinationen sich ergeben, ob sich gar noch eine ganz andere Siegstrategie finden lässt“, schreibt er. Für ihn ergibt sich immer wieder ein „hoher Wiederspielreiz“. Bartsch befindet: „Das ist gut designt.“¹
Auch Manuel Fritsch empfindet „The Vale of Eternity” zeitweise als „Glücksspiel“. Es sei aber auch ein Spiel „wo man die Interaktion nicht unterschätzen darf. Man sieht schon: Die Kreatur muss ich jetzt nehmen, weil sie jemand anderem zu viele Punkte bringt. Das ist eine zu starke Kombo“, sagt er. „Und das mag ich an ‚Vale of Eternity‘: Wir basteln nicht alle vor uns hin, sondern es ist wirklich entscheidend, zu gucken.“ Am Ende sei das Spiel ein „Wettrennen“. Der Spielspaß ergibt sich für Fritsch daraus, „diese coolen Kombos zu finden“. Deshalb funktioniere es nach zwei, drei Partien ein wenig besser: „Da hast du die Kreaturen alle schonmal gesehen, und dann wird das Spiel noch einen Ticken reizvoller“, sagt er. Das Spiel mache im Raum zwischen seiner „Kombinationsvielfalt“ und den Beschränkungen „mechanisch so vieles so elegant“, meint Fritsch, und das findet er „wirklich, wirklich toll“. Dass die Karten im Kreis ausgelegt werden, ist für ihn kein Problem. „Mein Gott, dann nimmt man sie halt kurz in die Hand und liest sie. Oder man liest sie gemeinsam durch. Nach ein paar Partien hat man die Karten dann auch drauf.“²
Für Tobias Franke ist ein Vorteil von „The Vale of Eternity“, „dass man mit wenigen Karten anfängt. Du kommst sehr gut in das Spiel rein, und je länger das Spiel geht, desto mehr Möglichkeiten hast du. Am Anfang ist das noch sehr begrenzt.“ Auch er weist auf die Glückskomponente hin: „Du bist immer von der Kartenauslage abhängig.“ Es gebe starke Kombinationen, aber auch nicht „diese eine Killerkombi. Je besser ich die Karten kenne, desto mehr bin ich im Vorteil.“ Gut findet er, dass die unterschiedlichen Farbfamilien aufeinander aufbauten. „Ich finde, dass die ihre eigenen Klammern haben.“ Franke hat allerdings auch Kritikpunkte: „Wenn du am Anfang schlecht gespielt hast oder Pech hattest“, dann könne es sein, dass „der Zug abgefahren ist. Dann gucke ich den anderen dabei zu, wie sie den Sieg unter sich ausmachen“, sagt er. Außerdem reize ihn das – eher generische – Thema nicht. Zwar seien die „mechanischen Kniffe durchaus überzeugend“. Doch: „Wenn da eine andere Verpackung darauf wäre, das wäre das i-Tüpfelchen. Ich finde das ein tolles Spiel, aber es emotionalisiert mich nicht, es nimmt mich nicht mit“, schließt Franke.³
Martina Fuchs „muss jede Runde mit dem klarkommen, was da aufgedeckt liegt“. Weiter sagt sie über „The Vale of Eternity“: „Ich versuche irgendwelche coolen Kombinationen mit den Wesen zu bauen, möglichst eine Engine aufzubauen, die was miteinander zu tun hat.“ Allerdings spiele man das Spiel „nicht nur nebeneinander her. Man muss schon genau darauf achten, was die anderen machen. Wenn man den Leuten die Karten lässt, die viele Punkte bringen, wird es schwer, mitzuhalten.“ Es könne durchaus passieren, dass jemand 30 Punkte mehr hat als die anderen“, sagt sie. Dreh- und Angelpunkt sei für sie der Geldmechanismus mit seinen Beschränkungen. Das klappe „erstaunlich gut“. Die Freiheiten, die das Spiel lasse, gefallen ihr: „Ich kann so viele Karten auf der Hand haben, wie ich will, um mir auch die Möglichkeit zu lassen, zu reagieren.“ Außerdem sei – nach der Phase des Kartenziehens – „überhaupt nicht vorgeschrieben, wann ich welche Aktionen mache“. Dennoch seien die Regeln „für ein Spiel dieser Variabilität“ schlank, stellt sie fest. Ein kleiner Kritikpunkt ist für sie die Karten-Anordnung: „Ich kann die Karten nicht so legen, dass sie jeder immer lesen kann. Ich kann mir nur sehr schwer allein den Überblick über alle Karten holen.“ Zusammenfassend meint sie, dass das Thema cool und die Karten schön gezeichnet seien. Das mache Lust, es zu spielen.⁴
















 Auch Michaela Poignée ist von „Zug um Zug Legacy“ „total begeistert. Es ist eine tolle Legacy-Umsetzung zu einem wirklich tollen Spiel“, das sie neugierig gemacht habe, es zu erkunden: „Was kommt jetzt als nächstes? Welche Elemente kommen neu rein?“ Das sei manchmal so viel, dass man aufpassen müsse „dass man nichts vergisst“. Besonders würdigt sie den Einfallsreichtum des Autorentrios: „Ich muss echt sagen: Hut ab, da hat man sich richtig tolle Sachen einfallen lassen“, sagt Poignée. Für sie ist das Spiel eine unbedingte Empfehlung. Ihr einziger Kritikpunkt: „Es ist jetzt vorbei.“
Auch Michaela Poignée ist von „Zug um Zug Legacy“ „total begeistert. Es ist eine tolle Legacy-Umsetzung zu einem wirklich tollen Spiel“, das sie neugierig gemacht habe, es zu erkunden: „Was kommt jetzt als nächstes? Welche Elemente kommen neu rein?“ Das sei manchmal so viel, dass man aufpassen müsse „dass man nichts vergisst“. Besonders würdigt sie den Einfallsreichtum des Autorentrios: „Ich muss echt sagen: Hut ab, da hat man sich richtig tolle Sachen einfallen lassen“, sagt Poignée. Für sie ist das Spiel eine unbedingte Empfehlung. Ihr einziger Kritikpunkt: „Es ist jetzt vorbei.“




